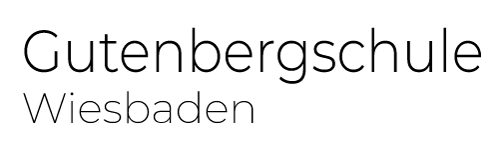Zehn Uhr vormittags. Aula der Gutenbergschule. 180 Schüler sind versammelt, und man könnte eine Stecknadel fallen hören. Auf dem Podium berichten vier Gäste aus Warschau von ihren schlimmen Erlebnissen während der Besetzung ihres Landes durch Nazideutschland. Nach dem Überfall auf Polen im September 1939 wurden die Schulen geschlossen, Lehrer, Pfarrer, Ärzte, die Intelligenz des Landes verhaftet.
Bei der heute 88jährigen Sabina Nawara traf es die gesamte Familie, die im Widerstand engagiert war. Zehn Tage Verhöre bei der Gestapo („Sie wollten Namen wissen.“), ein Zeitraum, über den sie ansonsten schweigt. Dann Transport nach Auschwitz, wo die Ankömmlinge kahl geschoren wurden, Tätowierung der Häftlingsnummer, Baracken, harte Arbeit, schlechtes Essen. „Wir hatten eine Zahnbürste, kein Handtuch, keine Toiletten“, erinnert sich Pani Sabina.
Eugeniusz Dąbrowskis Familie wurde denunziert, weil sie einem jüdischen Freund Zuflucht gewährte. Mitten in der Nacht stand ein SS-Kommando vor der Tür. „Zum Glück war der Jude zu diesem Zeitpunkt nicht bei uns, sondern im Haus einer meiner Schwestern. Sonst wären wir sofort erschossen worden“, sagt Dabrowski. Anders als in den übrigen besetzten Ländern galt in Polen auf das Verstecken von Juden die Todesstrafe. So wurden Mutter, drei Schwestern, ein achtjähriger Neffe und der junge Dabrowski „nur“ nach Auschwitz gebracht. Wie die anderen Zeitzeugen wurde er durch verschiedene Lager geschleust, musste in der Waffenproduktion arbeiten.
Schikanen, Übergriffe, willkürliche Festnahmen prägten die deutsche Besatzungszeit. Nach dem von der polnischen Heimatarmee organisierten Warschauer Aufstand Anfang August 1944 begannen die Nazitruppen, die Stadt zu evakuieren, Block für Block abzufackeln. Überall auf den Straßen lagen Leichenberge, die mit Benzin übergossen und angezündet wurden. „Am 10. August 1944 begann meine persönliche Tragödie“, erzählt Maria Stroińska, die damals 12 Jahre alt war. Wie viele andere wurde auch ihre Familie aus der Wohnung gezerrt, der Vater vor ihren Augen erschossen, die Mutter schwer verletzt. Die vier Jahre ältere Schwester kam ins KZ Neuengamme bei Hamburg, Maria selbst mit einem Kindertransport nach Auschwitz. Es folgte der harte Frostwinter 1944, pseudomedizinische Versuche durch den berüchtigten KZ-Arzt Dr. Josef Mengele, die Evakuierung von Auschwitz, lange Fußmärsche nach Osten. Schließlich das „happy end“ mit der Rückkehr ins zerstörte Warschau. Die Mutter, krank zwar, hatte überlebt. „Ich hatte keine Kindheit“, sagt Maria Stroińska.
Ob und wie sie diese traumatischen Erfahrungen verarbeitet haben, wollen die Gutenbergschüler wissen. Beiseite geschoben, ausgeblendet, jahrelang – so sei sie mit den Leiden umgegangen, erklärt die 88jährige Alina Dąbrowska. In beeindruckend gutem Deutsch übrigens, denn sie hat vor dem Krieg im Gymnasium die Sprache gelernt. „Wenn mich eine Bekannte aus dem Lager auf der Straße ansprach, sagte ich, ich kenne Sie nicht, ich war nicht dort.“ Unter langärmligen Pullovern habe sie die eintätowierte KZ-Nummer verborgen. Sie habe fünfzig Jahre gebraucht, bevor sie erstmals nach Auschwitz fahren konnte. So wie Maria Stroińska. Ob ihnen die Religion geholfen habe, und was die schlimmsten Ereignisse gewesen seien, fragen die Schüler weiter. Ja, der Glaube sei eine wichtige Stütze, sagen die Gäste. Gemeinsam hätten die Häftlinge Lieder gesungen und gebetet, die Hoffnung nicht aufgegeben.
Die schlimmsten Ereignisse? Die Nacktheit bei der Ankunft im KZ, sagt Sabina Nawara. Männer, Frauen, Junge, Alte. Ein Schock. Für Eugeniusz Dabrowski Weihnachten 1944: Während die Wachen „O Tannenbaum“ sangen, versuchten er und ein Mitgefangener, hungrig, Kartoffelschalen zu stehlen. Sie wurden entdeckt, misshandelt, schwer verletzt.
Die Polen freuen sich über das Interesse der Jugendlichen. Nach dem Krieg habe sie zunächst Angst gehabt, Deutsche zu treffen, sagt Alina Dąbrowska. Aber sie sei freundlich aufgenommen worden. Den Kontakt nach Deutschland ermöglicht unter anderem der Evangelische Verein Zeichen der Hoffnung. Die Initiative mit Sitz in Frankfurt am Main, die seit 1977 besteht, versteht sich als deutsch-polnisches Versöhnungswerk. Sie unterstützt ehemalige KZ-Häftlinge und organisiert regelmäßig Kuraufenthalte.
Sabina Nawara bemerkt „viele traurige Gesichter“ im Publikum. Aber „das sind Leiden der Vergangenheit. Wir sind nicht hier, um anzuklagen.“ Immer wieder betonen die Gäste, die Bedeutung freundschaftlicher Beziehungen, Frieden, zumindest in Europa. Ihre Botschaft an die jungen Wiesbadener: „Seid aufmerksam, wenn respektlos mit Menschen umgegangen wird und engagiert euch, schreitet ein.“